Schätzungen zufolge lebt jeder siebte junge Mensch zwischen 10 und 19 Jahren mit einer diagnostizierten psychischen Beeinträchtigung oder Störung wie Angststörungen, Depressionen oder Verhaltensauffälligkeiten. Das geht aus dem aktuellen „Bericht zur Situation der Kinder in der Welt 2021“ des UN-Kinderhilfswerks UNICEF hervor. Wie sehr die Corona-Pandemie, zunehmende Klimakatastrophen und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges Kinder und Jugendliche belasten, darüber hat Prof. Dr. Hans-Henning Flechtner im Interview gesprochen.
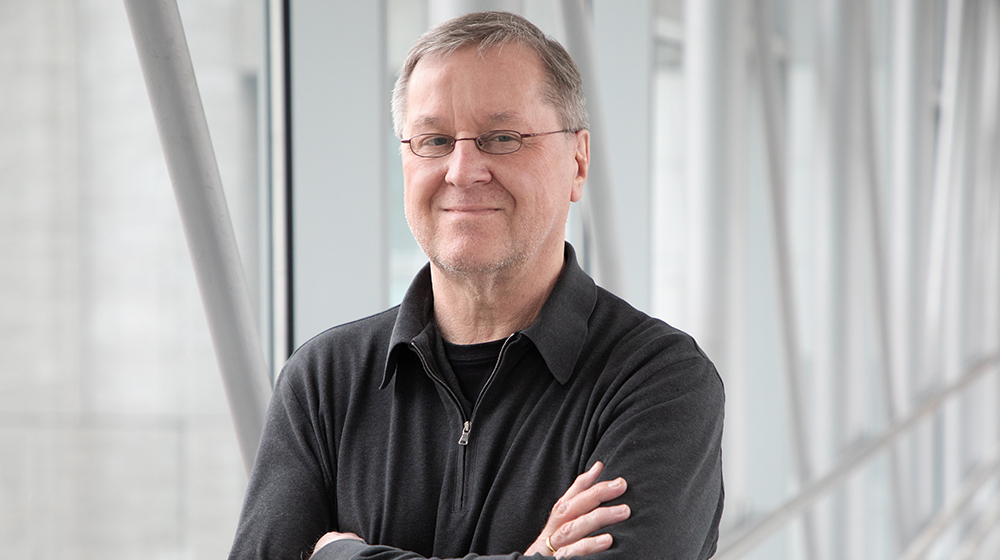 Prof. Flechtner (Foto: Melitta Schubert / UMMD)
Prof. Flechtner (Foto: Melitta Schubert / UMMD)
Als Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie, und Psychosomatische Medizin des Kindes- und Jugendalters hat er den diesjährigen 37. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) mit organisiert. Vom 18. bis 21. Mai 2022 treffen sich über 1.200 Expertinnen und Experten, um unter anderem über die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Klimakrise und des Ukraine-Krieges auf die kindliche Psyche zu diskutieren.
Interessierte Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychologie, Psychotherapie, Ergotherapie, Musiktherapie, Bewegungstherapie sowie der Pädagogik und des Pflege- und Erziehungsdienstes können sich auf der Website des Kongresses anmelden.
Aber auch für Schulklassen gibt es Programmpunkte, für die sie sich anmelden können.
Die Welt hat aktuell drei große Krisen zu bewältigen: die Corona-Pandemie, den Klimawandel, den Krieg in der Ukraine. Wie beeinflusst das die Psyche unserer Kinder?
Vor Kurzem wurde eine neue Jugendstudie veröffentlicht, die zeigt, was diese drei Krisen mit Jugendlichen machen. Dazu wurden etwa 1.000 Kinder und Jugendliche befragt. Unbestritten ist, dass diese Ereignisse Angst machen, Besorgnis hervorrufen und auch eine Belastung darstellen. Vor einiger Zeit stand noch die Pandemie im Vordergrund; im Moment rückt der Krieg in der Ukraine in den Vordergrund. Das hat nichts damit zu tun, was wirklich bedeutsamer ist. Man könnte ja meinen, die Klimakrise ist das langfristig Bedeutsamere und müsste bei der jungen Generation mehr grundsätzliche Angst auslösen. Aber hier spielt das Zeitgeschehen eine ganz große Rolle. Es ist zum Beispiel bekannt, dass der Angstinhalt bei Kindern und Jugendlichen, die sich in der physiologischen Entwicklung zwischen 8 bis 12 Jahren befinden, sehr stark durch das aktuelle Geschehen bestimmt wird. Früher gab es das Ozonloch, das Waldsterben oder andere Ängste und jetzt sind es eben die drei genannten Krisen, die Angst machen.
Werden die Kinder und Jugendlichen dadurch auch im Erwachsenenalter ängstlicher oder macht sie das resoluter?
Also dass sie dadurch ängstlicher werden, kann man nicht sagen. Man hat auch, glaube ich, eine ganz falsche Vorstellung, wie empfindlich Kinder und Jugendliche sind. Wenn sie das wären, hätte die Menschheit nicht überlebt, weil Kinder – auch kleine Kinder – sehr resilient, also sehr widerstandsfähig gegen äußere Ereignisse sind. Und solche Phasen können bei gesunder psychischer Entwicklung eher zu mehr Stabilität führen, als dass Kinder und Jugendliche in zehn oder 20 Jahren ängstliche Erwachsene werden.
Nun haben die psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren stark zugenommen. Hat das nur etwas mit diesen drei Krisen zu tun oder sehen Sie auch andere Ursachen?
Die drei Krisen sind ja relativ aktuelle Krisen. Die Klimakrise gibt es schon länger, aber in der Zuspitzung auch erst seit wenigen Jahren. Die Zunahme von psychischen Belastungen ist aber etwas, was schon die letzten 20 Jahre beobachtet wird. Wobei man da sehr vorsichtig sein muss: Teilweise ist die Rede davon, dass 1/3 aller Kinder psychisch beeinträchtigt sind. Eine psychische Belastung ist noch keine psychische Störung und ist noch keine psychiatrische Erkrankung. Das heißt also, es wird mehr wahrgenommen, es werden unter Umständen auch mehr Belastungen deutlich. Es sind vielleicht auch Unterstützungssysteme nicht mehr so leistungsfähig wie früher, also soziale Gemeinschaften und ähnliches. Wir sehen auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Kliniken in den letzten Jahren mehr Notaufnahmen, mehr akute Krisen-Aufnahmen; wobei niemand sagen kann, worauf das wirklich zurückzuführen ist. Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Man muss aber sehr vorsichtig sein, Belastung gleichzusetzen mit psychischer Erkrankung und Störung.
Und dennoch ist es sehr schwer, wenn man dann wirklich eine psychische Erkrankung hat, einen Termin zu bekommen. Wie deckt sich das?
Ich gebe Ihnen mal ein kleines Beispiel: Ich bin Ende der 80er Jahre nach Köln gekommen. Zu der Zeit gab es dort nur wenige niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater. Niedergelassene Psychologen, Psychotherapeuten gab es damals praktisch kaum. Das heißt, der ganze Köln-Bonner-Großraum war mit zwei Kinder- und Jugendpsychiatern versorgt. Als ich 2006 nach Magdeburg ging, gab es zwei große psychiatrische Kliniken, eine große Tagesklinik und etwa 50 niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater. Und man fragt sich: Die haben alle lange Wartezeiten – was war dann eigentlich in den 80er Jahren? Das kann Ihnen niemand beantworten. Einerseits werden natürlich kritische Geister sagen „Es werden auch viele Befindlichkeitsstörungen behandelt, die gar keine Erkrankungen sind.“ So weit würde ich definitiv nicht gehen. Aber wo ein Bedarf ist und wo Leute sind, die den Bedarf stillen können, da wächst natürlich auch die Nachfrage.
Sind dann angesichts des vermehrten Bedarfs die Versorgungsangebote ausreichend? Oder was genau müsste sich aus Ihrer Sicht verbessern?
Bestimmte Berufsverbände, gerade auch im Bereich der Psychotherapeuten, fordern sehr stark, dass die Therapeutenlandschaft deutlich ausgedehnt werden muss. Auch jetzt durch die krisenhaften Zuspitzungen mit traumatisierten Kriegsflüchtlingen, die eine Akutversorgung brauchen. Auf der anderen Seite machen wir auch die Erfahrung, dass, wenn es gar keine Wartezeit gibt, häufig die Motivation, etwas zu verändern, etwas zu tun, was ja auch wirklich anstrengend ist, sehr schnell zusammenbricht. Und es ist etwas anderes, ob ich akute Zahnschmerzen habe und einen Zahnarzt brauche oder ob ich eine psychische Krise habe und zum Beispiel bei uns in der Klinik vorstellig werde, für einen Tag aufgenommen werde, dann erst mal wieder entlassen werde und dann zwei, drei, vier Wochen auf den Therapieplatz warten muss.
Das führt eher dazu, dass jemand noch mal darüber nachdenkt: Brauche ich den Platz? Brauche ich den wirklich? Will ich den wahrnehmen? Und weil er mit einer gewissen Wartezeit erst zur Verfügung steht, einfach noch mal eine Klarheit entstehen kann über das, was die Person tatsächlich möchte. Das heißt, Wartezeiten sind nicht nur etwas Schlechtes. Beim Zahnarzt muss der meinen Zahn reparieren. Bei einer Psychotherapie muss ich selber etwas tun und ich bekomme die Sache nicht auf dem Silbertablett serviert.
Eltern haben oft die Vorstellung: „Das Kind hat ein Problem, das gebe ich in der Klinik ab und die sollen mir sagen, wenn es repariert ist, dann hole ich es wieder ab.“ So funktioniert das natürlich nicht. Ein Kind ist kein zu reparierendes Auto. Es ist Aufwand notwendig. Veränderungen müssen errungen werden und sind nicht sofort umsetzbar. Von daher ist es eine komplexe Situation: Betroffene sollten nicht ein Jahr auf einen Platz warten, aber es muss auch nicht morgen sofort der Platz da sein. In manchen Bereichen gibt es sicher überlange Wartelisten, in anderen ist es aber durchaus angemessen. Und für eine akute Krisensituation gibt es immer die Klinik, wo man sofort hingehen kann.
Jetzt waren die Kontakte zwei Jahre lang wegen der Pandemie stark eingeschränkt. Müssen Kinder und Jugendliche den Umgang mit Gesellschaft wieder lernen?
Es ist natürlich so, dass bestimmte Kinder und Jugendliche, die sowieso sozial nicht so fähig sind, Schwierigkeiten haben, in Gruppen zurecht zu kommen, sich mehr zurückgezogen haben, mehr in sozialen Medien unterwegs waren, weniger in der realen Welt. Und die müssen tatsächlich wieder an die reale Situation herangeführt werden. Und das sehen wir schon, ohne dass hier gültige Zahlen vorliegen, dass solche Rückzüge tatsächlich stärker stattgefunden haben bedingt durch Lockdown, durch Schulschließungen oder durch Umstellung auf digitalen Unterricht; aber das betrifft sicher nicht alle, sondern nur bestimmte Gruppen von Kindern und Jugendlichen.
Als Beispiel: Die Corona-Beschränkungen sind weitgehend entfallen; im Geschäft sehen Sie eine Gruppe von Leuten, die immer noch Maske trägt, die immer noch Abstand hält und andere nicht mehr. Und so ist die Situation auch bei Kindern; einige können nahtlos anknüpfen, wieder zur Normalität übergehen und bestimmte Gruppen sind zurückhaltender und tun sich schwerer z.B. auch in Sportvereinen wieder anzukommen.
 Einige Kinder müssen nach den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie den Umgang mit der Gesellschaft wieder neu lernen (Foto: Shutterstock / L Julia)
Einige Kinder müssen nach den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie den Umgang mit der Gesellschaft wieder neu lernen (Foto: Shutterstock / L Julia)
Wie kann man Kinder dabei unterstützen?
Es ist wichtig, Anknüpfungen im Freizeitbereich, in der Schule, mit Freunden wieder herzustellen und diesem Rückzug entgegenzuwirken. Nun ist es ja grundsätzlich ein Problem, dass es Kinder und insbesondere Jugendliche gibt, die über den Medienkonsum reale Bezüge zurückfahren. Wir haben zum Beispiel Jugendliche in der Behandlung, deren soziale Kontakte sehr ausgedehnt sind, aber nur digital. Wenn man fragt, was denn mit echten, realen Freunden ist, stößt das häufig auf Irritation, weil die Idee ist „Aber das sind doch reale Freunde“. Aber dass gar kein realer Kontakt da ist, sondern alles vermittelt wird über soziale Medien, das gerät leicht aus dem Blick. Also da hat sich sowieso was verschoben, was natürlich durch die Pandemie noch viel stärker in ungünstiger Weise befördert wurde.
Die Zukunft der heranwachsenden Generation kann sehr beängstigend sein: Die Prognosen für den Klimawandel sehen nicht gut aus, die wirtschaftliche Entwicklung stagniert, der Krieg in der Ukraine droht zu eskalieren. Wie können Kinder und Jugendliche dennoch ihr Leben unbeschwert genießen?
Also ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, dass man Belastungen nicht gleich gleichsetzt mit: „Hier kann man gar nicht mehr lachen, hier kann man gar nicht mehr unbeschwert sein.“ Es ist oft so, dass Dinge nebeneinander bestehen. Das heißt, dass durchaus unbefangene Situationen da sind und dann in einer anderen Situation wieder eine Befangenheit, eine Belastung auftritt. In den letzten Tagen war zum Beispiel die Bundesregierung im Schloss Meseberg in Klausur und, ich glaube, Habeck war es, der gesagt hat: „Na ja, es ist aber nicht so, dass wir nur Sorgenfalten auf der Stirn gehabt haben. Es wurde auch gelacht und miteinander gescherzt“. Das heißt, es steht nebeneinander und das eine entwertet nicht das andere und das andere entwertet nicht das eine. Es ist die Frage, wie kann man eine Balance finden, sodass es nicht bagatellisiert wird und weggelacht wird und gleichzeitig nicht alles in ernsthafter Sorge versinkt ohne einen Blick nach vorne zu haben.
Das ist auch etwas, was wir uns für den Kongress vorgenommen haben, dass wir natürlich nicht wegschauen können jetzt bei dem Kriegsgeschehen, bei der Klimakrise und bei der Pandemie. Aber dass wir trotzdem aufgefordert sind, unsere Arbeit zu machen und trotzdem uns damit zu beschäftigen.
Ein gut behütet behütetes Elternhaus ist da sicher extrem wichtig. Wie können Eltern dem Kind ein Gefühl von Sicherheit geben? Und wie sollten sie mit Ängsten umgehen, sie aktiv ansprechen oder lieber nicht?
Sichere Elternhäuser leben davon, dass die Eltern selber Sicherheit vermitteln können. Und natürlich werden auch Eltern sich Gedanken machen über die Situation und werden dadurch beeinträchtigt sein. Aber eine funktionsfähige Beziehungs- und Familiensicherheit wird dadurch nicht sofort außer Kraft gesetzt. Es kommt darauf an, dass Eltern in einer nüchternen Art und Weise altersgerecht mit den Kindern die Dinge besprechen. Und auch mit dem 5-jährigen Kind kann man über das Thema Krieg und Klima sprechen. Und weil ein Dialog, ein Gespräch darüber stattfindet, bannt man schon viel an Phantasien, die sonst ungreifbar sind. Dadurch bilden die Eltern ein Rollenmodell für die Kinder, wie die Eltern damit umgehen. Das heißt, wenn die Kinder lernen, dass die Eltern etwas vor ihnen verbergen wollen, dann ist das schwierig. Wenn die Kinder lernen, dass die Eltern es nicht verbergen, aber auch nicht zusammenbrechen durch die Belastung, sondern dem auch standhalten können und die Familie dem gemeinsam standhalten kann, dann ist das eigentlich der beste Weg, um damit umzugehen.
Eltern, die selber unter Angststörungen leiden, psychisch erkrankt sind, die das gar nicht aushalten können, werden natürlich sehr viel weniger ihren Kindern Sicherheit geben können. Und das ist natürlich grundsätzlich das Thema, dass Kinder psychisch kranker Eltern sehr viel vulnerabler sind als Kinder, die in einem stabileren Elternhaus aufwachsen und für diese sind natürlich solche äußeren Belastungssituation schon schwerer zu verkraften, weil sie weniger Unterstützung durch die Eltern bekommen können.
Wie können Eltern denn erkennen, dass ihr Kind psychische Probleme hat und an wen können sie sich dann wenden?
Eltern sollten immer darauf achten, ob sich im Verhalten, in der Stimmung des Kindes etwas verändert, ob zum Beispiel das Thema Suizidalität irgendwie anklingt. Das gelingt natürlich nur, wenn die Eltern mit den Kindern im Austausch, im Gespräch sind. Wenn zum Beispiel keine gemeinsamen Mahlzeiten stattfinden, man sich überhaupt nicht begegnet, dann werden Eltern das erst viel später mitbekommen. Aber im Prinzip ist die Frage: Merke ich, dass sich etwas beim Kind verändert? Dann muss ich das Gespräch suchen und mir gegebenenfalls einfach Rat holen. Das kann zuerst der Kinderarzt sein, das kann eine Vorstellung bei einem Kinderpsychologen sein, das kann bei uns in der Ambulanz sein. Das kann im Krisenfall auch mal eine Vorstellung im Notdienst sein. Man sollte sich dann nicht scheuen, sich Hilfe zu holen und die Frage zu stellen, ob hier etwas ist, was behandlungsbedürftig ist. Unter Umständen reicht ein einfaches Beratungsgespräch und die größten Sorgen lösen sich schon mal auf.
Vom 18. bis 21. Mai findet der 37. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie statt. Womit beschäftigen Sie sich auf diesem Kongress und wer kann daran teilnehmen?
Der Kongress ist der große Kongress unserer wissenschaftlichen Fachgesellschaft, der alle zwei Jahre stattfindet und an dem alle Disziplinen teilnehmen, die sich mit der psychischen Gesundheit, der psychischen Erkrankung von Kindern und Jugendlichen und Familien beschäftigen – also ärztliche Kinder- und Jugendpsychiater, psychologische Kinder- und Jugendtherapeuten, Sozialarbeiter, pädagogische Fachkräfte, Fachtherapeuten wie Musiktherapie, Ergotherapie, Bewegungstherapie, aber auch die Pflege; also multiprofessionelle Experten nehmen an diesem Kongress teil.
Schwerpunkt ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Studien, Erkenntnissen, Untersuchungen, aber auch Diskussionen, Umsetzung in praktische Handlungsfelder. Es gibt ein breites Spektrum an Fortbildungskursen für bestimmte Themen. Und wir haben den Kongress unter die drei Großthemen „Corona, Krieg und Klimawandel“ gestellt – einige der 150 Programmpunkte werden sich fokussiert mit diesen Themen beschäftigen. Das gesamte Programm finden Interessierte auf der Website des Kongresses. Es gibt auch für Schüler einige Programmpunkte, sodass auch Schulklassen teilnehmen können. Über die Website kann man sich direkt online anmelden; das geht auch noch, während der Kongress bereits läuft.
