+Hannah+Theile+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22-p-1312.jpg)
Magdeburg ist nicht nur bekannt durch den Dom und die Elbe, sondern auch Otto-Stadt! Und das natürlich wegen Otto dem Großen. Im Mai jährt sich zum 1050. Mal sein Todestag - ein Anlass ihm zu Gedenken und sein Leben zu feiern! Warum Otto eine so große Bedeutung für Magdeburg hat, was man über ihn wissen sollte und warum man sich auch 1000 Jahre nach seinem Tod noch mit dem Großen beschäftigen sollte, das erklärt Historiker Prof. Stephan Freund im Interview.

+Jana+Du%CC%88nnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22.jpg)
+Hannah+Theile+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22-p-856.jpg)
+Anna+Friese+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22-p-1094.jpg)
+Sarah+Kossmann+UMMD-height-560-width-1000%22-p-1196.jpg)
+Christian+Morawe+UMMD-height-560-width-1000%22.jpg)
Franziska+Anhalt-height-560-width-1000%22-p-2156.jpg)
+und+Martin+Roye+(rechts)+mit+dem+Elektrorennwagen+von+UMD+Racing+(Foto_+Hannah+Theile+_+Uni+Magdeburg)-height-560-width-1000%22.jpg)
+Hannah+Theile+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22-p-1578.jpg)
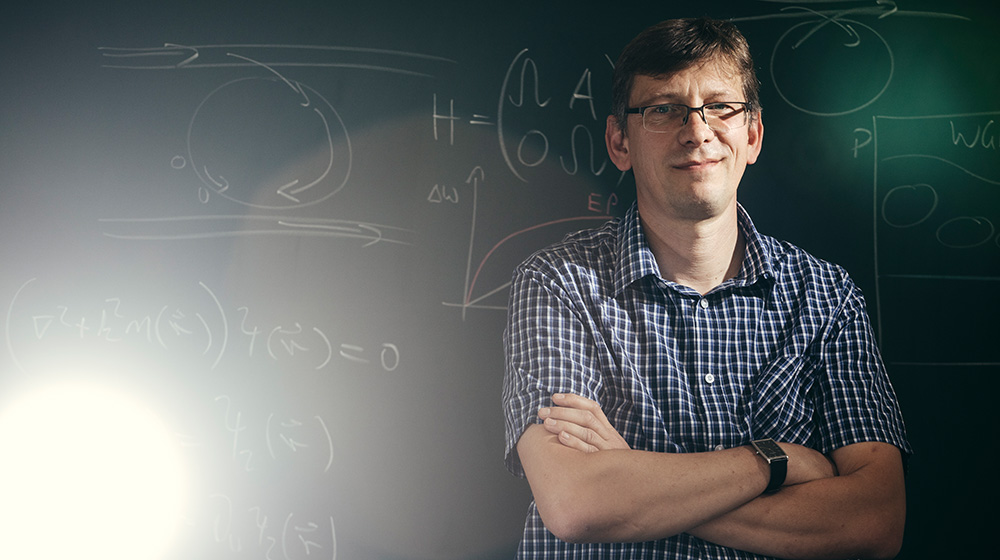
+Linn_Kristin+Adler-height-560-width-1000%22-p-1947.jpg)

+Jana+Dünnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22-p-1686.jpg)
+Jana+Dünnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22-p-1668.png)
+Jana+Du%CC%88nnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22-p-1482.png)
+Sarah+Kossmann+Universitätsklinikum-height-560-width-1000%22.jpg)
+Shutterstock+Dragana+Gordic-height-560-width-1000%22-p-932.jpg)
+Jana+Dünnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22.jpg)
+privat-height-560-width-1000%22-p-330.jpeg)
+Jana+Dünnhaupt-height-482-width-861%22-p-698.jpg)
+Gotthard+Demmel-height-560-width-1000%22.jpg)

+führen+gemeinsam+ein+Experiment+für+die+Zusammenarbeit+von+Mensch+und+Roboter+durch+(c)+Jana+Dünnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22-p-1522.png)
+Jana+Dünnhaupt+Uni+Magdeburg+Kopie+2-height-560-width-1000%22-p-1859.jpg)
+Jana+Dünnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22.jpg)
+Tom+Schulze-height-560-width-1000%22-p-1548.jpg)
+Jana+Dünnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22.jpg)
+Jana+Dünnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22-p-1732.jpg)
+Jana+Dünnhaupt+Uni+Magdeburg-height-535%22-width-955.png)
+Alfred_Wegener_Institut+_+Esther+Horvath-height-560-width-1000%22-p-1412.jpg)
+Jana+Du%CC%88nnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22.jpg)
+Jana+Du%CC%88nnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22.jpg)
+Jana+Dünnhaupt+Uni+Magdeburg+_+Kopie-height-560-width-1000%22-p-94752.jpg)
+Nils+Thomas+_+Max_Planck_Institut+Magdeburg-height-560-width-1000%22-p-1810.jpg)
+privat-height-560-width-1000%22-p-1736.jpg)
+Hannah+Theile+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22.jpg)
+Jana+Dünnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22-p-1728.jpg)
+CBBS-height-560-width-1000%22.jpg)
+Hannah+Theile+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22.jpg)
+Chay+Tee+Shutterstock-height-560-width-1000%22.jpg)
+Hannah+Theile+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22.jpg)
+Melitta+Schubert_Unimedizin-height-560-width-1000%22-p-1718.jpg)

+Jana+Dünnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22.jpg)
+Jana+Du%CC%88nnhaupt+Uni+Magdeburg-height-560-width-1000%22-p-832.jpg)